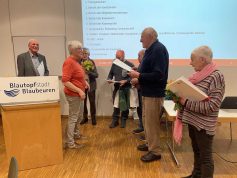Am Samstagmorgen trafen sich bei schönstem Wanderwetter 9 mutige Wanderer zur 2-Tagestour am Güterbahnhof in Blaubeuren.

Mit zwei Autos fuhren wir nach Frankenhofen um dort die 3. Etappe Richtung Tuttlingen zu beginnen. Auf breiten Kieswegen wanderten wir durch Felder, Wiesen und Wälder nach Granheim, wo im Backhaus frisch duftendes Brot im Ofen war. Dort folgten wir dem Wanderweg zur Marienkapelle, an der der Granheimer Kreuzweg endete. Weiter ging es ins Wolfstal bis oberhalb von Erbstetten, wo wir bei schönstem Sonnenschein unsere wohlverdiente Mittagsrast machten.
Anschließend kam der landschaftlich schönere Teil der Wanderung. Über den Heumacherfelsen kamen wir zur Ruine Wartstein, die über dem Großen Lautertal thront:


Von dem Turm der Ruine Wartstein ging es auf Wegen mit alpinem Charakter hinunter ins Große Lautertal zum Hohen Gießel, einem schönen Wasserfall.

An mehreren kleinen Höhlen mit den sprechenden Namen Heuscheuerle, Schwarzlochfelsen und Ochsenlöcher ging es im Tal weiter bis zur Ölmühle, wo wir uns im Schatten am Grill- und Spielplatz ein Lautertaleis gönnten.
Bis zu unserem Quartier, dem Flair-Hotel Hirsch in Indelhausen, war es nun nicht mehr weit. Dort hatten wir vor dem Abendessen noch Zeit für ein kühles Bier, eine kalte Dusche oder einfach nur für eine kleine Pause.
Den schönen Wandertag ließen wir gemeinsam beim Essen und anschließenden gemütlichen Beisammensein in der Gaststube ausklingen.
Der zweite Tag (Muttertag) starteten wir mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet im Hotel. Anschließend ging es zurück bis zur Ölmühle, wo wir am Tag zuvor für die Übernachtung den HW2 verlassen hatten. Ein kurzer Aufstieg führte uns dann zur Ruine Maisenstein mit Hofgut und neu gebautem Hotel. Durch wunderschöne Obstbaumwiesen ging es weiter auf der Hochebene Richtung Hayingen.



Nachdem wir Hayingen durchquert hatten, kamen wir durch das Naturschutzgebiet Digelfeld, wo wir weidende Schafe und auch blühende Orchideen sahen:

Unsere heutige Mittagsrast legten wir bei der Hayinger Brücke ein. Von dort ging es weiter durch das sehr beschauliche Glastal, wo wir am Hasenbach entlang bis zum abenteuerlichen Aufstieg zur Ruine Ehrenfels wanderten.

Vorbei am Schloss Ehrenfels, das in Privatbesitz ist und nicht besichtigt werden kann, führte uns der Weg zur Wimsener Höhle. Dort hatten wir eine Führung mit dem Boot in die wasserführende Höhle gebucht. Das war sehr eindrucksvoll.

Danach ging ein schöner Pfad entlang der Zwiefalter Ach bis nach Gossenzugen, wo wir unsere heißgelaufenen Füße im Kneippbecken in der Ach abkühlen konnten.

Die letzten Meter bis nach Zwiefalten waren dann nicht mehr schwer, weil man schon von ferne die beiden Türme des Zwiefalter Münsters sehen und somit das Ziel vor Augen hatte.

Nach einem kurzen Rundgang durch das Münster und 16,6km von Tag 1 und 16,9km von Tag 2 hatten wir uns die Schlusseinkehr im Brauhaus in Zwiefalten redlich verdient und ließen es uns gut schmecken.

Vielen Dank an die tolle Wandergruppe.
Ulrike Müller