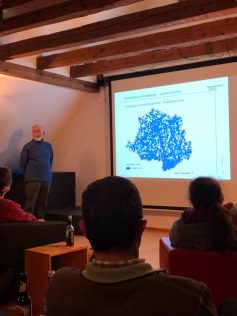Dieser Bericht über den Vortrag von Christian Hajdukist zum Thema „Wohin mit der Windkraft“ ist in der Schwäbischen Zeitung erschienen:
DAS SAGT DER NATURSCHUTZ ZUM WINDENERGIEAUSBAU IN DER REGION
„Ein sportliches Ziel“: Naturschutzwart Christian Hajduk bezweifelt einen rechtskräftigen Regionalplan für Windkraftanlagen bis Jahresende.
 Nicht nur viele Bürger sehen den Ausbau der Windkraft im nördlichen Alb-Donau-Kreis kritisch. Neben den allgemeinen Planungen zweifeln Experten auch die zeitliche Umsetzung an. Bis 31. Dezember 2025 soll der „Regionalplan Windkraftanlagen“ unter Dach und Fach sein, – ein „sportliches Ziel“, war das Fazit von Christian Hajduk aus Lonsee, Gau-Naturschutzwart des Schwäbischen Albvereins, bei seinem gut besuchten Vortrag in Blaubeuren. Veranstalter war der Albverein.
Nicht nur viele Bürger sehen den Ausbau der Windkraft im nördlichen Alb-Donau-Kreis kritisch. Neben den allgemeinen Planungen zweifeln Experten auch die zeitliche Umsetzung an. Bis 31. Dezember 2025 soll der „Regionalplan Windkraftanlagen“ unter Dach und Fach sein, – ein „sportliches Ziel“, war das Fazit von Christian Hajduk aus Lonsee, Gau-Naturschutzwart des Schwäbischen Albvereins, bei seinem gut besuchten Vortrag in Blaubeuren. Veranstalter war der Albverein.
Hajduk ist Mitglied im „Bundesverband Windenergie (BWE)“ und erwies sich als kompetenter Referent mit gutem Kartenmaterial bei der Vorstellung des bisherigen Diskussionsstands unter besonderer Berücksichtigung der Region Laichingen-Blaubeuren und den angrenzenden Gemeinden im nördlichen Alb-Donau-Kreis. Er stellte dar die seit 2023 geltenden Rahmenbedingungen: Bundesweit sollen 2 Prozent der Landesflächen für Windkraftanlagen zur Verfügung stehen, in Baden-Württemberg und Bayern 1,8 Prozent.
Im Rahmen von Regionalplänen sollen geeignete Vorranggebiete ausgewiesen werden unter Berücksichtigung der Stellungnahmen von Naturschutzverbänden. „Spezialität“ in Baden-Württemberg sei, dass vor allem Waldgebiete ausgewiesen wurden – zum Schutz des unter Artenschutz stehenden Milans. Dieses Ziel sei inzwischen jedoch nachrangig, da der Milan durch ein neues „Antikollisionssystem“ geschützt werden könne. Nach der neuen Regelung des Landes sei eine „Verhinderungsplanung“ durch die Regionen nicht mehr möglich, da bei Nichterfüllung flächendeckend eine „Superprivilegierung“ drohe: Danach könnte „jedermann“ interessengeleitet einen Antrag stellen, die Folge wäre ein „ungeregelter Wildwuchs“ (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete ausführlich).
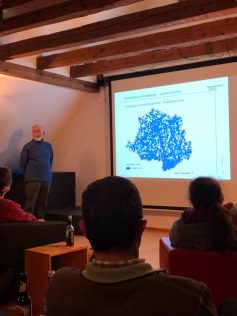 Geplant war ein landesweites rationales und nachvollziehbares Verfahren ohne Willkür. In der Region Donau-Iller komme erschwerend hinzu, dass Entscheidungen bundeslandübergreifend getroffen werden müssten. Denn die Region umfasst den Alb-Donau-Kreis, Stadtkreis Ulm, Kreis Biberach, auf bayrischer Seite den Landkreis Neu-Ulm, Günzburg und den Stadtkreis Memmingen. Nach heutigem Stand sind 0,43 Prozent der Regionsfläche auf 2300 Hektar mit Windkraftanlagen bebaut, – nach der Zielvorgabe müssen 1,8 Prozent auf einer Fläche von 10.000 Hektar bebaut werden, „das Vierfache“. Die bisherigen 37 Vorranggebiete müssten entsprechend auf 100 erhöht werden. Ein „Schwarz-Weiss-Plan“ jeder Region müsse vorgelegt werden, darin ermittelt werden geeignete „Windpotenzialflächen“, die eine mittlere Windleistungsdichte von 215w/qm in 160 Metern Höhe erreichen sowie „Ausschlussflächen“.
Geplant war ein landesweites rationales und nachvollziehbares Verfahren ohne Willkür. In der Region Donau-Iller komme erschwerend hinzu, dass Entscheidungen bundeslandübergreifend getroffen werden müssten. Denn die Region umfasst den Alb-Donau-Kreis, Stadtkreis Ulm, Kreis Biberach, auf bayrischer Seite den Landkreis Neu-Ulm, Günzburg und den Stadtkreis Memmingen. Nach heutigem Stand sind 0,43 Prozent der Regionsfläche auf 2300 Hektar mit Windkraftanlagen bebaut, – nach der Zielvorgabe müssen 1,8 Prozent auf einer Fläche von 10.000 Hektar bebaut werden, „das Vierfache“. Die bisherigen 37 Vorranggebiete müssten entsprechend auf 100 erhöht werden. Ein „Schwarz-Weiss-Plan“ jeder Region müsse vorgelegt werden, darin ermittelt werden geeignete „Windpotenzialflächen“, die eine mittlere Windleistungsdichte von 215w/qm in 160 Metern Höhe erreichen sowie „Ausschlussflächen“.
Ausgeschlossen für die Bebauung mit Anlagen sind demnach Siedlungsflächen und ein angemessener Abstand dazu, Verkehrsflächen wie Autobahnen, Flugplätze, Hochspannungsleitungen, Bundeswehrgebiete mit Hubschraubertiefflugstrecken, Naturschutzgebiete und Biospärenreservate. Landschaftsschutzgebiete sind nicht mehr ausgeschlossen, jedoch andere bereits beschlossene Vorranggebiete, die dem Naturschutz oder der Rohstoffgewinnung dienen.
„Ziemlich schräge Verteilung von Windkraft“
Die „Windkarte“ Hajduks für die Region Donau-Iller zeigt überzeugend die Fakten: Blau-, Donau- und Illertal sind windstille Zonen, – also ungeeignet -, hervorragend dagegen eignet sich die Laichinger Kuppelalb und ein kleineres Gebiet um Biberach. 70 Prozent der regionalen Gesamtfläche fallen schon mal weg wegen Siedlungsnutzung. Als weitere Ausschlussgebiete erweisen sich das Gebiet um den Flughafen Memmingen sowie die von der Bundeswehr beanspruchten Flächen mit Hubschraubertiefflugstrecken um Laupheim.
Christian Hajduk erklärte: „Blaubeuren hat Glück, selbst eine Windkraftanlage auf dem Hochsträß fiele in den Einzugsbereich des Flughafens Laupheim“. Unter weiterer Berücksichtigung des Arten-und Naturschutzes sind 87 Prozent der Region von Ausschlusskriterien betroffen. Und letztendlich kommen nur noch 7,8 Prozent der Regionsfläche für Windkraftanlagen in Betracht. Entsprechend ergäbe sich in der Region „eine ziemlich schräge Verteilung“, so Experte Christian Hajduk.
Kritisch zu sehen sei, dass die neuen Windräder auf der Alb relativ weit weg von den Verbrauchsstellen errichtet würden: „Die Wieland Werke im bayrischen Vöhringen verbrauchen ein Drittel des Gesamtstroms der Region.“ Ein weiteres Problem aus der Sicht des Naturschutzwartes ist der „massive Eingriff in die relativ intakte Natur auf der Schwäbischen Alb“, die Windräder am Albtrauf sind weithin sichtbar. Ein erster Vorschlag des Planungsausschusses im März 2024 wurde verworfen, in einen neuen Entwurf wurden aufgenommen „nachgemeldete Ergänzungsflächen“ durch die Bürgermeister des Alb-Donau-Kreises: Gemeindeeigene Flächen sollten, als Vorranggebiete aufgenommen werden, um Pachteinnahmen für die Gemeinden zu sichern. Hajduk betonte: „Eine Goldgräberstimmung brach aus. Es geht um 150.000 Euro Pacht pro Jahr für jede Anlage, die nicht dem Gemeindefinanzausgleich unterliegen“, – nicht nur „private Grundeigentümer“ sollten von den Anlagen profitieren.
„Lastwagenweise“ Stellungnahmen abgegeben
Hajduk kritisierte jedoch, dass durch diese „Grätsche der Bürgermeister“ der Alb-Donau-Kreis seinen Beitrag zu Windvorrangflächen fast verdoppelte. In Laichingen standen „11 Prozent der Gemeindefläche zur Debatte“, was zu erheblichen Protesten, Diskussionen im Stadtrat und einer entsprechenden Stellungnahme führte, die Frist ist im Oktober 2024 abgelaufen. Hajduk zitierte Gerüchte, denen zufolge in der benachbarten Region Neckar-Alb „lastwagenweise“ protestierende Stellungnahmen abgegeben worden seien. Nach deren Sichtung ist nach einer Überarbeitung eine erneute Auslegung geplant.
In der anschließenden Diskussionsrunde wurde die grundsätzliche Zustimmung zum Bau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen geäußert. Alternative Standorte, etwa der stillgelegte Truppenübungsplatz Münsingen wurden gegensätzlich diskutiert. Kritisiert wurde die Vernachlässigung der Forschungen zu „Energiespeicherung“ und „Wasserstoff“ in den vergangenen Jahrzehnten sowie die fehlenden Auflagen zur Energieeinsparung: „Warum werden nächtliche Leuchtreklamen nicht verboten, die nachweislich das Insektensterben mitverursachen?“
Quelle: Schwäbische Zeitung Laichingen, 11.2.2025
Von: Ilse Fischer-Giovante
Fotos: Bodo Schackow/dpa und Ilse Fischer-Giovante